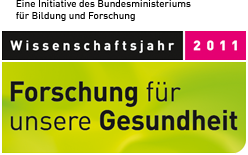Interview: „Wir suchen die Ursache für chronisches Asthma“
 Prof. Erika von Mutius, Ludwig-Maximilians-Universität München, Dr. von Haunersches Kinderspital, Leiterin der Asthma- und Allergieambulanz
Prof. Erika von Mutius, Ludwig-Maximilians-Universität München, Dr. von Haunersches Kinderspital, Leiterin der Asthma- und Allergieambulanz
Professorin Erika von Mutius arbeitet nicht nur als Ärztin an der Kinderklinik der Universität München, sondern auch als passionierte Wissenschaftlerin. Mit einem Team des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL) will sie jetzt herausfinden, warum sich Asthma bei einigen Kindern auswächst und bei anderen nicht.
Frau Professor von Mutius, Sie forschen bereits seit Mitte der neunziger Jahre zum Thema Asthma bei Kindern. Was finden Sie aus medizinischer Sicht so spannend daran?
Erika von Mutius: Das Schlimmste am Asthma ist die permanente, dauerhafte Belastung. Die Betroffenen müssen ständig Medikamente nehmen und sind im Alltag stark eingeschränkt, wenn sie durch Allergien oder Anstrengung Schwierigkeiten beim Atmen bekommen. Andererseits wissen wir, dass die Erkrankung in ländlichen Regionen Afrikas oder auch Osteuropas seltener vorkommt und meist milder verläuft. Mich interessiert also die Frage: Woran liegt das und wie kommen wir dahin zurück? Auch auf die Gefahr hin, dass wir künftig ein paar weniger Kinder-Lungenfachärzte brauchen könnten: Mir geht es vor allem um die Prävention.
Aktuell beschäftigen Sie sich aber eher mit der Frage, wie Asthma als chronische Krankheit überhaupt entsteht.
Erika von Mutius: Richtig. Bei etwa der Hälfte aller Kleinkinder verschwindet das Asthma bis zum siebten Lebensjahr wieder. Bei der anderen Hälfte wird es chronisch, die Betroffenen leiden auch als Erwachsene noch unter Anfällen. Im Deutschen Zentrum für Lungenforschung wollen wir zunächst untersuchen, welche Einflussgrößen den Verlauf beeinflussen. Dazu werden wir bei insgesamt 800 Kindern über einen längeren Zeitraum hinweg genetische Faktoren, die Auswirkung von Umwelteinflüssen und Reaktionen des Immunsystems in den Blick nehmen.
Welche Erkenntnisse versprechen Sie sich davon?
Erika von Mutius: Nehmen wir zum Beispiel die mit Asthma verbundene Entzündung der Atemwege: Bislang wissen wir nicht, wodurch sie überhaupt unterhalten wird. Viele asthmakranke Kinder haben häufig virale Infekte. Sind also Viren für die Entzündung verantwortlich? Oder doch die Allergene? Oder müssen wir uns ähnlich wie beim Darm eher die Bakterien in der Lungenflora angucken? Auf solche Fragen wollen wir Antworten finden.
In Deutschland leiden rund zehn Prozent aller Kinder an Asthma. Wie könnten sie von den Ergebnissen profitieren?
Erika von Mutius: Wenn wir bestimmen könnten, wie eine Asthmaerkrankung weiter verläuft, könnten wir sie besser behandeln. Wüsste man zum Beispiel von vorneherein, dass sie chronisch wird, könnte man dauerhaft entzündungshemmende Medikamente verabreichen. Vielleicht ließe sich so die Lungenfunktion dauerhaft gut erhalten.
Warum ist es so schwierig, bei Kindern überhaupt eine sichere Diagnose zu stellen?
Erika von Mutius: Die ersten Lebensjahre entscheiden, wie gesagt, über den Krankheitsverlauf. Bestimmte Lungenfunktionstests kann man aber erst ab einem Alter von sechs Jahren durchführen. Zwar können wir im Blut Asthma-typische Immunreaktionen nachweisen. Für eine sicherere Diagnose bräuchten wir aber noch andere, eindeutige Einflussgrößen wie eben die genetischen Faktoren.
Beim Stichwort Gentests schrillen doch sicher bei vielen Eltern die Alarmglocken.
Erika von Mutius: Dieses Dilemma spielt heute nur noch eine untergeordnete Rolle. Denn wir wissen bereits, dass es das eine Asthma-Gen nicht gibt. Vielmehr spielen viele unterschiedliche genetische Konstellationen eine Rolle. Gleichzeitig haben wir in einer früheren Studie nachgewiesen, dass nur etwa 38 Prozent der Kinder mit einer bestimmten Konstellation auch tatsächlich an Asthma erkranken. Deshalb brauchen sich auch die Eltern nicht automatisch zu sorgen, ob ihr Kind nun ein bestimmtes Gen hat oder nicht.
Was raten Sie denn den Eltern asthmakranker Kinder im Alltag, worauf müssen Sie achten?
Erika von Mutius: Im Beisein von Kindern ist Rauchen absolut tabu. Es ist darauf zu achten, dass es keinen Schimmelpilzbefall in der Wohnung gibt, der die Atemwege reizen könnten. Wohnt die Familie an einer stark befahrenen Straße, könnte man überlegen, ob nicht auch ein Umzug sinnvoll wäre – obwohl die Symptome dadurch nur leicht besser werden. Und klar: Ist das Kind gegen Tierhaare allergisch, müssen Hund oder Katze weg, sonst wird es immer schlimmer.
Zur Person:
Professorin Dr. Erika von Mutius ist Oberärztin an der Dr. Haunerschen Kinderklinik der Ludwigs-Maximilian-Universität München und leitet dort die Asthma- und Allergieambulanz. Ihre Leidenschaft für die Wissenschaft entdeckte sie Anfang der neunziger Jahre an der Universität in Tucson, Arizona: 1992 ermöglichte ihr ein Forschungsstipendium für das Respiratory Sciences Center einen einjährigen Aufenthalt. Seither hat sie sich auf Asthmaerkrankungen bei Kindern spezialisiert. Im Jahr 2010 erhielt sie etwa eine der begehrten Förderungen des Europäischen Forschungsrates (ERC). Bei dem Forschungsvorhaben entdeckte sie mehrere Substanzen, die Bauernhofkinder vor Allergien schützen und eines Tages für Impfungen eingesetzt werden könnten.
Über das Deutsche Zentrum für Lungenforschung (DZL):
Im DZL werden ab Ende 2011 mehr als 170 Lungenspezialisten aus 18 wissenschaftlichen Einrichtungen an fünf Standorten acht Krankheitsgruppen erforschen, darunter Asthma und Allergien, Mukoviszidose, Lungenhochdruck und Lungenkrebs. In München sind unter anderem die Ludwigs-Maximilians-Universität und das Helmholtz Zentrum in das DZL eingebunden. Weitere Standorte gibt es in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hessen und Baden-Württemberg.
Das DZL ist eines von insgesamt sechs Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung mit unterschiedlichen Schwerpunkten, darunter die Herz-Kreislauf-, Infektions- und Krebsforschung. In den Zentren arbeiten künftig Spitzenwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler aus mehr als 120 Forschungseinrichtungen an 39 Standorten eng zusammen. Das Ministerium für Bildung und Forschung fördert den Aufbau bis 2015 mit rund 700 Millionen Euro.