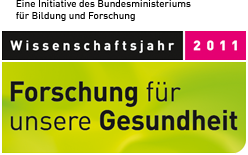Gesundheit in Tönen
Fredrik Vahle ist einer der bekanntesten deutschen Kinderliedermacher und erforscht als Linguist die Entwicklung der kindlichen Sprache. Dabei richtet er sein Augenmerk insbesondere auf solche Dimensionen des Sprechens, die dem Bedeuten der Sprache noch vorgängig sind: zum Beispiel die Körperhaltung des Sprechers, Gebärden, den Stimmklang und die Stimmführung.
Und obwohl Sprachwissenschaftler, Genetiker, Hirnforscher, Evolutionsbiologen und Entwicklungspsychologen seit Jahrzehnten rätseln, wie Kleinkinder tatsächlich eine Sprache erwerben – was etwa ist genetisch festgeschrieben und was aus der Umwelt erlernt? –, steht eines mittlerweile fest: Sprechen lernen heißt zunächst einmal zuzuhören. Damit beginnen Kinder bereits im Mutterleib. Melodien, Rhythmen, Betonungen der Muttersprache hinterlassen Spuren im Gedächtnis der noch Ungeborenen. Sie werden differenziert wahrgenommen – noch vor den ersten eigenen Sprechversuchen.
Die Musik in der Sprache
Hören – nach den musikalischen Strukturen in der Sprache – steht also am Anfang allen Sprechens. Dass die Musik für den Spracherwerb ein große Rolle spielt, steht auch für Fredrik Vahle außer Frage. So zählen erste Kinderworte wie „Mama“ und „Papa“ noch verstärkt zu der elementaren Sprache der Rhythmen und Klänge, auch wenn sie bereits auf die Welt verweisen.
„Für ein Kind, das sprechen lernt, ist Sprache nämlich primär kein Medium von Nachrichtenübermittlung und Verständigung durch den Austausch von Gedanken. Vielmehr bemüht sich das Kind in diesem langwierigen Prozess vor allem um Entdeckung, Inbetriebnahme und Differenzierung seiner artikulatorischen Beweglichkeit“, schreibt Vahle. Schließlich erfordert die Produktion eines einzelnen Sprachlauts die Koordination vieler Millionen Nervenzellen, die für die Wahrnehmung, Aufmerksamkeitssteuerung, Gedächtnis und motorische Kontrolle der Muskeln und Sehnen des Sprechapparats zuständig sind.
Vom Brabbeln zum Rechnen
Aus dem Brabbeln, Lallen und Singsang von Säuglingen, das zunächst die Stimme artikulatorisch trainiert, entsteht schließlich die Fähigkeit, mit der Umwelt zu kommunizieren. Auch der Bewegungstherapeut Dierk Zaiser weist darauf hin, dass in der frühen Phase der Sprachentwicklung Musik und Sprache kaum zu trennen sind und enge Zusammenhänge zwischen neuronalen Verbindungen und Musikaktivitäten bestehen, die auch einen Transfereffekt auf den kindlichen Spracherwerb haben.
So betont Fredrik Vahle die Wichtigkeit von Liedern, Reimen und Bewegung für die pädagogische Arbeit mit Kindern, also auch den Spracherwerb. Eine empirische Untersuchung der Musikpädagogen Karl Adamek und Thomas Blank bestätigt: Tägliches Singen fördert die gesunde physische und psychische Entwicklung von Kindern. Nicht nur der Spracherwerb und die soziale Kompetenz werden gesteigert, sondern auch die Lesefähigkeit, das Erinnerungsvermögen, die mathematischen Fähigkeiten und der Intelligenzquotient nehmen zu – im Vergleich zu Kindern, die musikalisch nicht gefördert werden. Der Neurowissenschaftler Laurel Trainor fand heraus, dass Musik das wachsende Gehirn in positiver Weise verändert. Denn die Hirnregionen, in denen syntaktische Informationen über Sprache und Musik verarbeitet werden, überlappen sich teilweise. So trainiert vor allem das aktive Musizieren das Verstehen und Regeln und Strukturen – für viele Kompetenzbereiche. Während Lärm krank machen kann und die Lebenqualität beeinträchtigt, bewirkt Musik das Gegenteil: Sie beeinflusst den kognitiven und emotionalen Apparat des Menschen positiv.