Gewinner und Verlierer des Klimawandels in Deutschland
Senckenberg-Studie untersucht verschiedene Tier- und Pflanzengruppen
Flamingos am Niederrhein? Dieses Szenario gehört noch der Zukunft an. Biologen beobachten aber eine Wanderung von Tieren und Pflanzen in Richtung der Pole. Sie folgen der durch den Klimawandel verursachten Verschiebung der Klimazonen. Auch in Deutschland reagieren bereits Vögel, Schmetterlinge und Käfer auf den Klimawandel. Das haben Wissenschaftler des Senckenberg Biodiversität und Klima Forschungszentrums in Frankfurt (BiK-F) herausgefunden. In Zusammenarbeit mit weiteren Senckenberg-Standorten und deutschen Partnerinstitutionen wurden erstmals Bestandstrends von sehr unterschiedlichen Artengruppen miteinander verglichen.

Neues aus der Wissenschaft

Aktuelle Meldungen
Entdecken Sie weitere aktuelle Meldungen aus der Wissenschaft.
Der Schwarzhalstaucher (Podiceps nigricollis) gehört zu den „Gewinnern“ des Klimawandels am Bodensee. Gleiches gilt für das Große Ochsenauge (Maniola jurtina), ein Schmetterling aus der Familie der Edelfalter in Sachsen. Ob der Rückgang der Uferschwalben-Population (Riparia riparia) am Bodensee mit dem Wandel des Klimas oder mit dem Landnutzungswandel zu tun hat, muss noch näher untersucht werden. Für Dr. Diana Bowler (BiK-F) steht jedoch fest: „Der längerfristige Bestandstrend spezifischer Tiergruppen hängt eng mit den ‚Temperaturnischen' zusammen, in denen die Tiere leben“, und Bowler ergänzt: „Unter Temperaturnischen versteht man die Temperaturbedingungen, unter denen Tiere und Pflanzen in ihrer natürlichen Umwelt gefunden werden."
Die Forscher konnten auf vorhandene Langzeituntersuchungen zu Populationstrends in verschiedenen Tier- und Pflanzengruppen aus Teilen Bayerns, Baden-Württembergs, Sachsens, Sachsen-Anhalts, der Schweiz und Österreichs zugreifen. Diese Breite zeichnet die Studie, die kürzlich im Fachjournal „Biological Conservation“ erschienen ist, auch vor vielen anderen Arbeiten aus. „Unser Ziel ist es, verlässliche Vorhersagen über die Auswirkungen des Klimawandels auf Artengruppen zu treffen und so auch entsprechende Schutzmaßnahmen für diese ergreifen zu können“, resümiert Bowler.

in Kooperation mit dem idw - Informationsdienst Wissenschaft
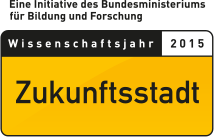

Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!