Die Zukunftsstadt braucht Freiräume für Experimente
Städteforscher verweisen auf das Beispiel Berlins in den 1990er Jahren
Die Städte der Zukunft stehen vor großen Herausforderungen; eine davon ist ihre ökonomische Kompetenz: Sie müssen wirtschaftsstark sein und zugleich innovativ, also neue Ideen generieren, katalysieren und verwerten können. Erleichtert wird dies, wenn die Städte möglichst viele Freiräume zum Experimentieren bieten, stellen Forscher des Leibniz-Instituts für Regionalentwicklung und Strukturplanung (IRS) im brandenburgischen Erkner in ihrem aktuellen Themenheft des Magazins „IRS aktuell" fest, und verweisen auf das Beispiel Berlins in der Nachwendezeit.

Neues aus der Wissenschaft

Aktuelle Meldungen
Entdecken Sie weitere aktuelle Meldungen aus der Wissenschaft.
„Die Stadt verfügte nach 1990 über einen großen Vorrat an innerstädtischen Brachflächen, die kostengünstig und kreativ genutzt werden konnten", erläutert IRS-Wissenschaftlerin Gabriela Christmann. Diese seien zum Teil im großen Stil „beplant" bebaut worden wie am Potsdamer Platz, andere Flächen seien „erobert" worden und würden teilweise temporär genutzt wie das ehemalige Tempelhofer Flugfeld oder die „Tentstation", die Zelten mitten in der Stadt anbot.
Entscheidend sei nicht nur die ideenreiche Nutzung brachliegender Flächen, sondern auch die kulturelle Inspiration und spontane Kreativität, die sich damit verbinde, fügt Christmann hinzu. Sie habe beigetragen zum Image Berlins als offene, tolerante Stadt und als Mekka der Start-up- und Kreativszene, was wiederum zu einer regen Innovations- und Gründungstätigkeit geführt habe. „Für die Zukunftsfähigkeit großer Städte in Bezug auf Innovationen ist es daher wichtig, solche Freiräume zu erhalten oder zu schaffen", sagt die Expertin.
Oliver Ibert vom IRS hebt hervor, dass große Städte Potenzial böten, gerade für soziale und dienstleistungsorientierte Neuerungen. Dafür seien keine teuren Labore nötig, erklärt der Forscher, sondern kostengünstige Freiräume und eine offene Kultur des Experimentierens. "Innovationen entstehen nicht nur in der Hochtechnologie oder in teuren Laboren", sagt Ibert unter Verweis darauf, dass sich die Wirtschaftsförderung vieler Städte auf die Unterstützung von Technologieparks oder Gründerzentren beschränke.

in Kooperation mit dem idw - Informationsdienst Wissenschaft
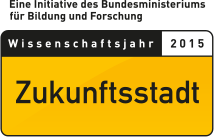


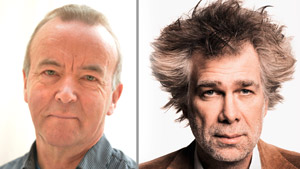



Kommentare (0)
Keine Kommentare gefunden!