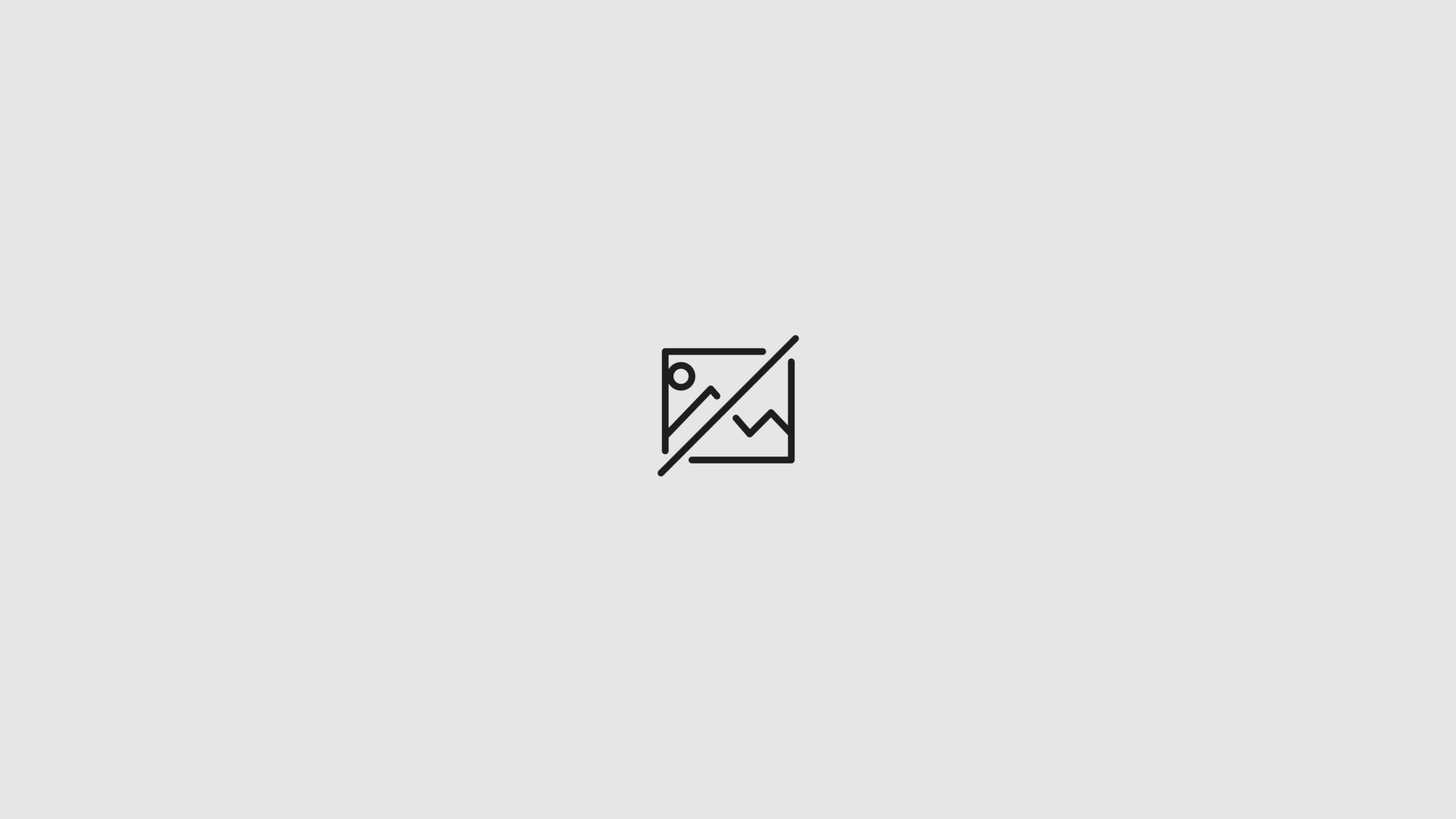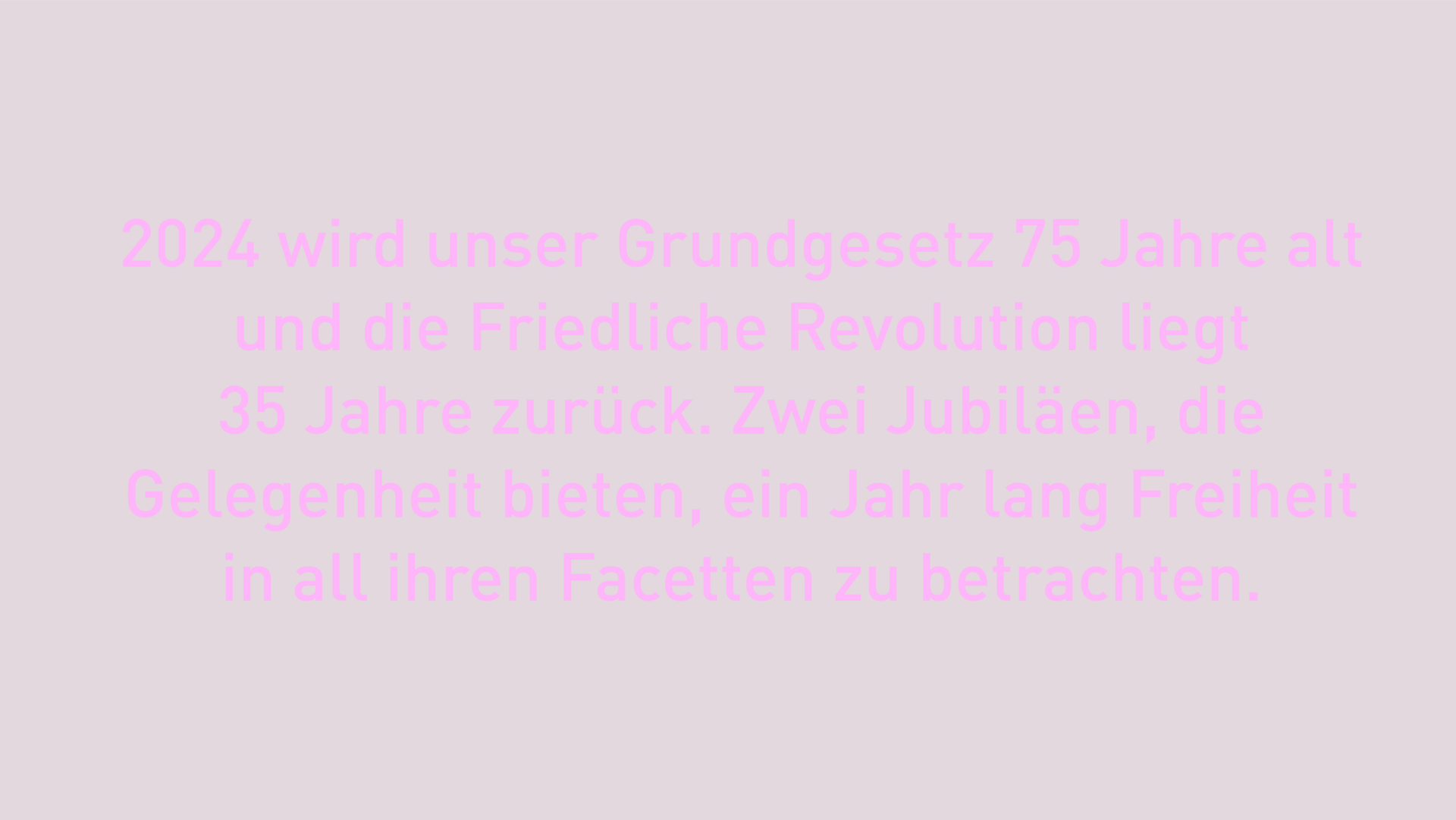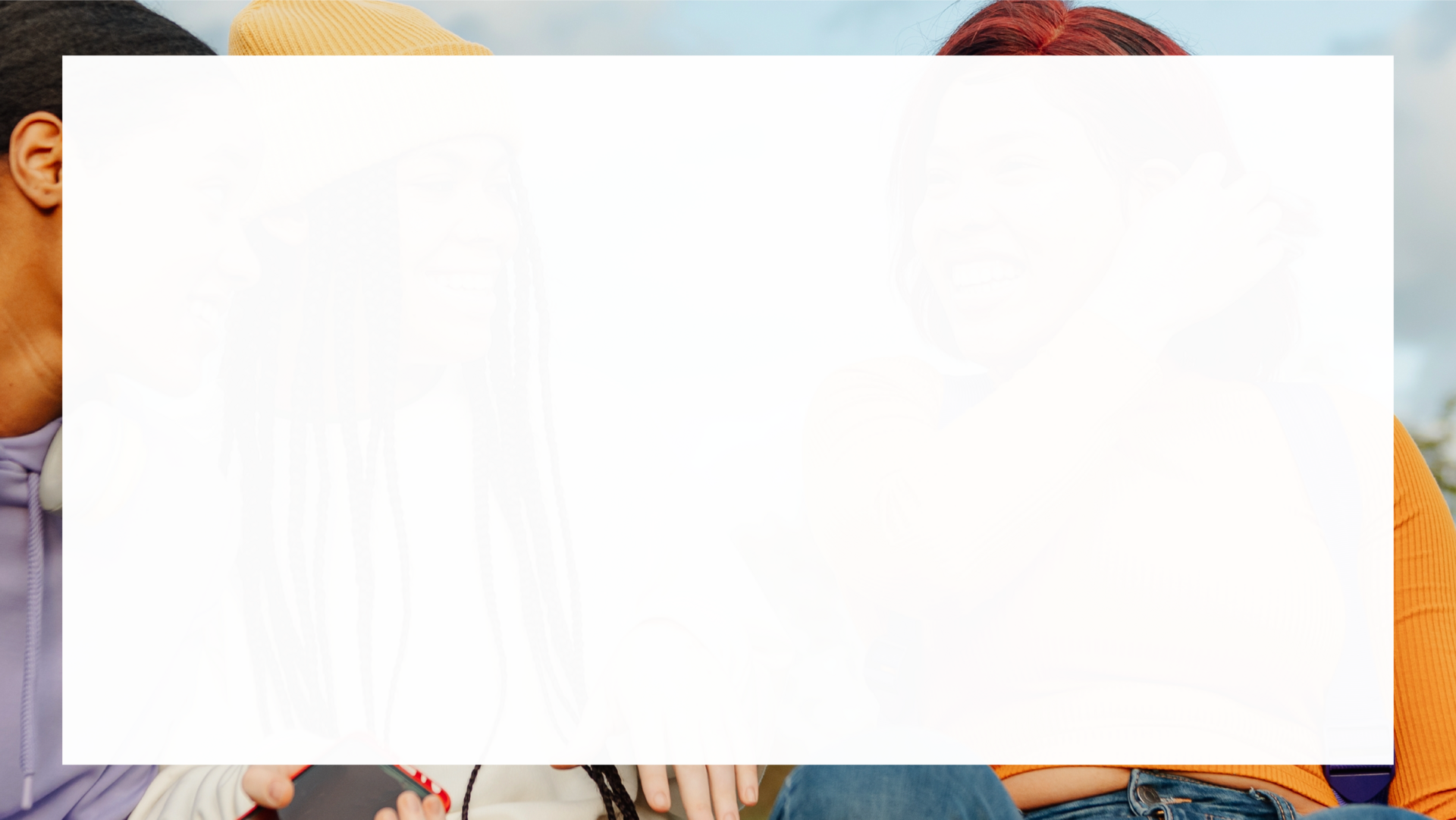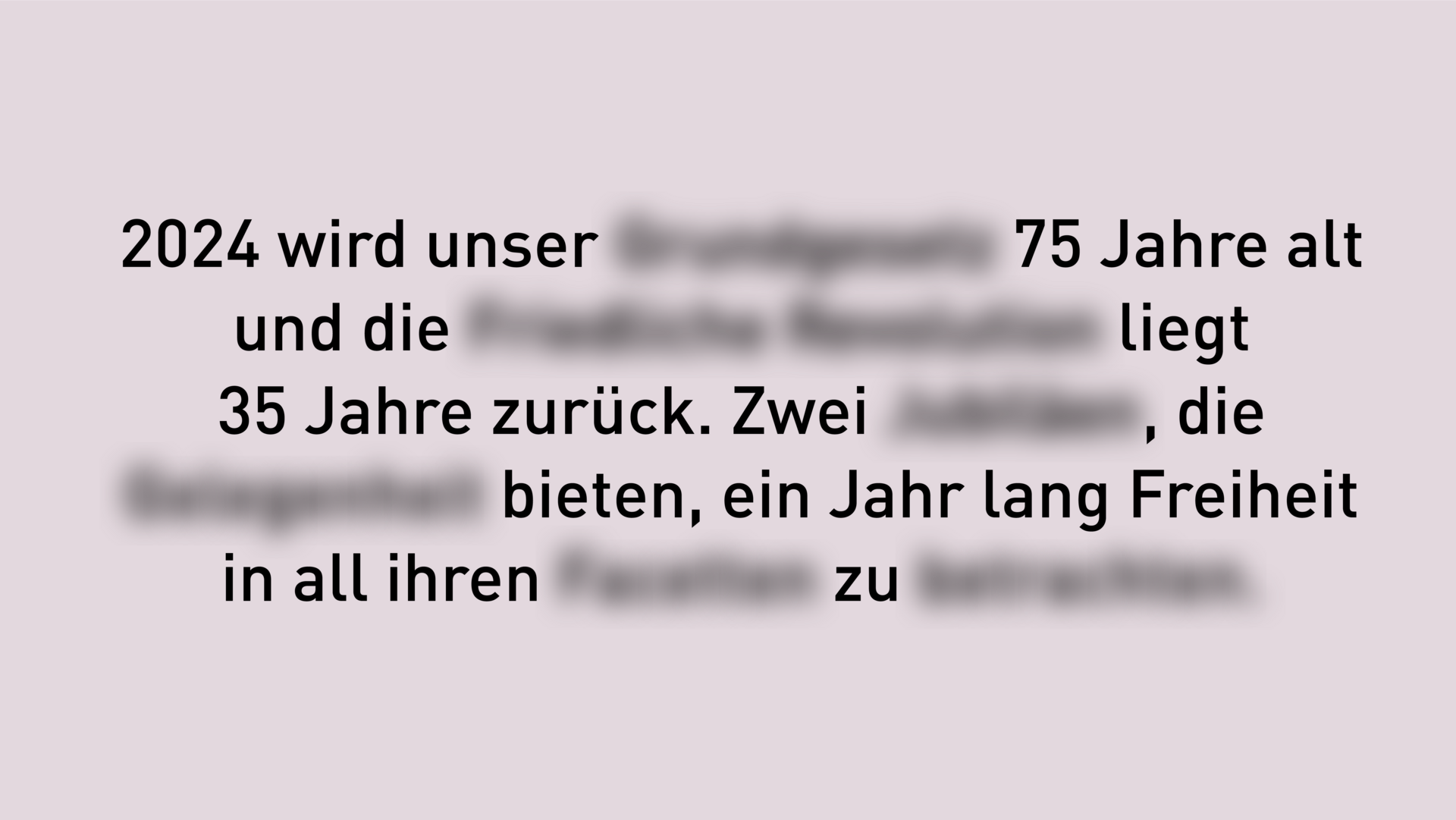Barrieren sind Hindernisse. Sie erschweren oder verhindern den Zugang zu Orten, Veranstaltungen oder Gebäuden. Aber sie stören nicht nur die Fortbewegung. Barrieren machen es auch unmöglich, bestimmte Produkte, Dienstleistungen oder Informationen zu nutzen. Nicht nur Menschen mit Behinderungen sind betroffen – viele unterschiedliche Faktoren wie Herkunft, Sexualität, Alter oder Geschlecht können einen Einfluss darauf haben, wie sehr Barrieren einschränken.
Barrieren
Was sind Barrieren?

Wo gibt es Barrieren?
Barrieren treten in vielen unterschiedlichen Lebensbereichen auf. Im öffentlichen Diskurs geht es oft um räumliche Barrieren. Aber auch Sprache, Produkte, Dienstleistungen oder Prozesse können Barrieren sein. Nicht immer sind sie auf den ersten Blick erkennbar.
-
Neben defekten Aufzügen und fehlenden Rollstuhlrampen existieren zahlreiche weitere Barrieren im öffentlichen Raum: nicht barrierefreie Haltestellen oder Verkehrsmittel im ÖPNV, fehlende Toiletten oder Parkplätze für Menschen mit Behinderungen, fehlende Handlaufsysteme in Brailleschrift, Blindenleitsysteme oder defekte Anzeigetafeln. Dazu kommt, dass viele Versorgungs- und Freizeiteinrichtungen wie etwa Praxen, Geschäfte oder Cafés schlecht zugänglich sind. Das schließt beispielsweise Menschen mit Geh-, Hör- oder Sehbehinderungen aus dem alltäglichen Leben aus. Zudem sind auch Menschen mit psychischen oder neurologischen Erkrankungen betroffen, etwa, wenn sie schnell reizüberflutet sind und keine Rückzugsräume zur Verfügung stehen.
-
Barrieren können auch in der Kommunikation auftreten. Unsere Amts- und Alltagssprache kann für einige Menschen schwer verständlich sein, etwa für Menschen mit Lernschwierigkeiten, Deutschlernende, alte Menschen oder Kinder. Sie benötigen Informationen in Leichter oder Einfacher Sprache. Fehlt diese Übersetzung, sind beispielsweise Nachrichten, bürokratische Texte oder auch typische Anweisungen bei einem Besuch in einer ärztlichen Praxis schwer bis gar nicht verständlich.
-
Einigen Menschen ist der Zugang zu Bildung erschwert. Von der frühkindlichen- bis zur Hochschul- und Weiterbildung gilt: Die Bildungschancen sind ungleich verteilt. Die soziale Herkunft, das Geschlecht, eine Behinderung oder Migrationsgeschichte können für Benachteiligungen sorgen. Lesen Sie hier, wie das Startchancen-Programm des BMBF dem entgegenwirkt.
-
Einige Produkte oder Dienstleistungen sind so aufgebaut, dass sie nicht von allen Menschen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Darunter fallen etwa E-Books, Fahrausweis-Automaten, Bankautomaten oder der Online-Handel. Gerade alten Menschen oder Menschen mit Behinderungen fällt die Bedienung oft schwer.
-
Manchmal schließen bestimmte Strukturen auch ganze Menschengruppen aus. Beispiele dafür sind der Aufbau unseres allgemeinen Arbeitsmarkts, unseres Bildungssystems und vieler Infrastrukturen. Daraus ergeben sich dann Ungleichheiten. Für bestimmte Menschen entsteht etwa ein – an objektiven Kriterien messbarer – erschwerter Zugang zum allgemeinen Arbeitsmarkt.
Welche Barrieren gibt es im Netz?
Noch immer enthalten eine Menge Websites und digitale Anwendungen Barrieren und sind dadurch für Viele nicht zugänglich.
Barrieren bei der Bedienung
Viele Menschen nutzen Hilfsmittel wie Screenreader (Bildschirmvorleser) oder Sprachsteuerung, um sich Inhalte vorlesen zu lassen und sich durch Seiten zu navigieren. Sind Seiten oder Inhalte nicht für solche Geräte optimiert, etwa durch eine falsche Überschriften-Hierarchie oder fehlende Verlinkungen, können sie von ihnen nicht genutzt werden. Auch wenn eine Website ausschließlich per Maus bedient werden kann, ist das für Menschen mit Sehbehinderung eine Barriere, weil diese oft per Tastatur durch Websites navigieren.
Beispiel: Keine Screenreader-Optimierung
Wenn Texte nicht für Screenreader optimiert sind, werden sie oft falsch oder gar nicht vorgelesen. So springen die Bildschirmvorleser zum Beispiel in der falschen Reihenfolge zwischen Absätzen hin und her, wenn die Überschriften-Hierarchie beim Einpflegen der Texte missachtet wurde oder Alternativtexte und Verlinkungen einzelner Elemente fehlen.
Barrieren in der Wahrnehmbarkeit
Zu kleine und nicht skalierbare Schriftgrößen oder geringe Kontraste können die Lesbarkeit und Sichtbarkeit von Texten und Inhalten einschränken. Wenn Website-Betreibende dem Bild- oder Videomaterial keine Alternativtexte, Transkripte oder Untertitel beifügen, folgt daraus ein eingeschränkter Zugang für Menschen mit Sehbehinderungen.
Barrieren bei der Verständlichkeit
Der Text auf einer Webseite kann unverständlich formuliert sein. Zudem ist es manchmal kompliziert, bestimmte Geräte zu bedienen oder Angebote zu nutzen. Auch sie können somit eine Barriere werden, wenn die Erklärung der Nutzung oder Navigation fehlt.
Was haben Barrieren mit Freiheit zu tun?
Wer von Barrieren eingeschränkt wird, spürt das oft nicht nur temporär. Und während einige Barrieren, wie ein fehlender Aufzug, Menschen offensichtlich Zugänge zu bestimmten Orten verwehren, sind andere für viele eher unsichtbar. Ein Beispiel: Fehlen erforderliche Informationen und Anträge in Leichter Sprache, benötigen einige Menschen Hilfe von anderen, um sich zu informieren oder Anträge auszufüllen. Sie können dann also nicht frei entscheiden, ob sie den Antrag lieber allein oder mit Hilfe eines anderen Menschen stellen.
Das Behindertengleichstellungsgesetz definiert Barrierefreiheit so: Sie ist dann gewährleistet, wenn Menschen sich frei und ohne Unterstützung oder Anpassungen bewegen und den öffentlichen Raum nutzen können.
-
Das Deutsche Institut für Menschenrechtesetzt sich dafür ein, dass Menschen mit Behinderungen ein Recht auf gleichberechtigte Teilhabe haben. Dafür sollen Barrieren abgebaut sowie die „ausgrenzenden Sonderwelten“ in den Bereichen Wohnen, Arbeit und Bildung aufgelöst werden.
-
Der Deutsche Behindertenrat (DBR) ist ein Bündnis aus Sozialverbänden, der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe sowie unabhängigen Behindertenverbänden. Er vertritt die Interessen von behinderten und chronisch kranken Menschen. Er will zum Beispiel die finanziellen Rahmenbedingungen sichern, die Menschen mit Behinderungen eine freie Lebensgestaltung ermöglichen. Der DBR ist Teil der Bundesinitiative Barrierefreiheit.