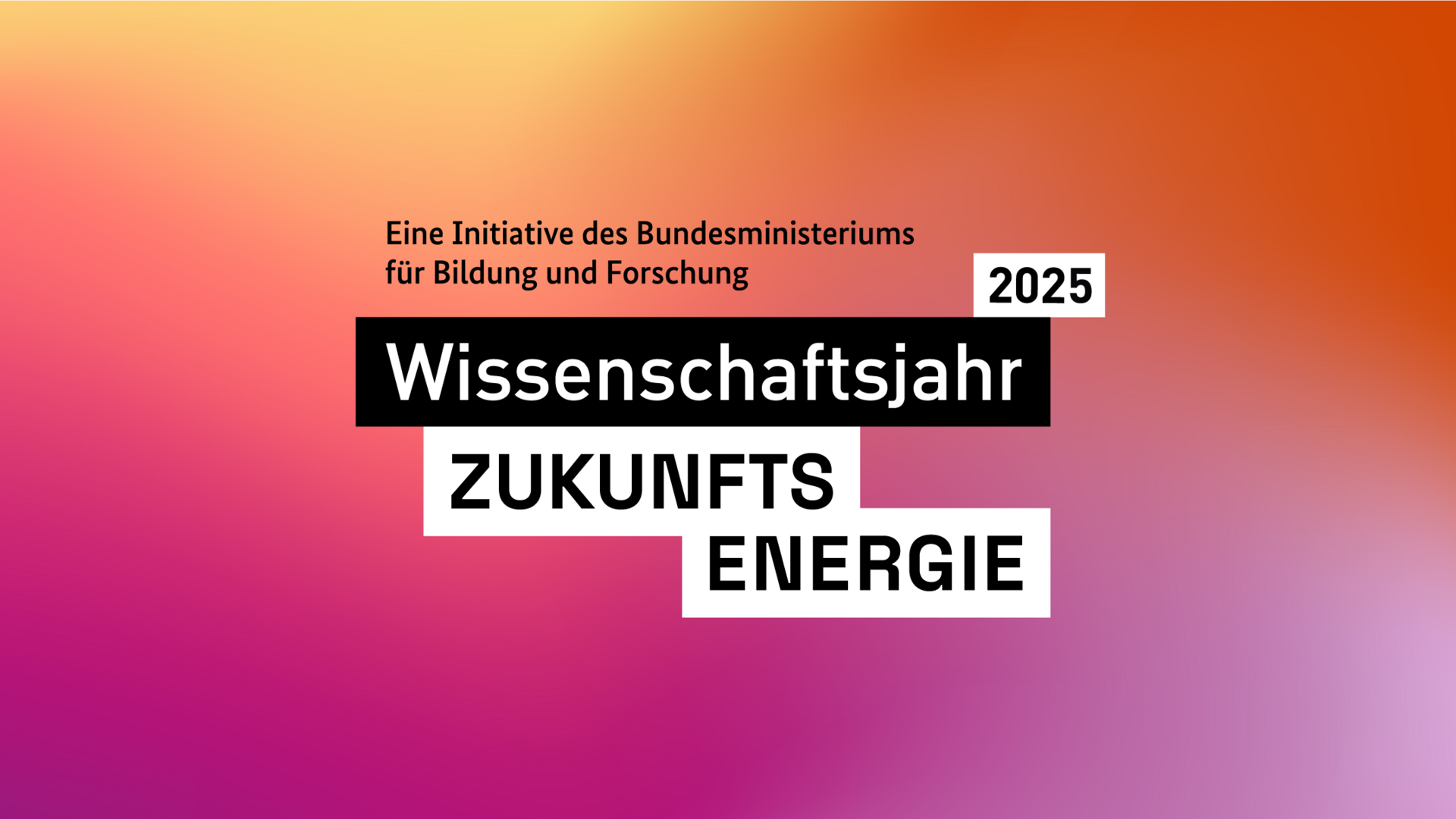Um Klimaschutz, Freiheit und Gerechtigkeit konstruktiv zusammenzudenken und neue Wege zu finden, brauchen wir die Auseinandersetzung in kontroversen Diskussionen sowie Teilhabe.
Freiheit und Klimaschutz stehen in einem komplexen und vielfältigen Zusammenhang: Klimaschutz ist nötig, um die Grundlagen für die Freiheit zu erhalten, ein selbstbestimmtes Leben zu führen – sowohl für die heutige als auch zukünftige Generationen. Gleichzeitig können Klimaschutzmaßnahmen individuelle Handlungsfreiheiten einschränken – auch dies gilt für zukünftige Generationen ebenso wie in der Gegenwart, wie das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2021 zeigt.
Welche Freiheiten eingeschränkt werden dürfen, um andere Freiheiten zu wahren, muss abgewogen werden und bedarf möglicherweise auch eines Ausdifferenzierens und Überarbeitens unseres Freiheitsverständnisses.
Energie für Freiheit – Freiheit und Gerechtigkeit im Klimaschutz
Ein Beitrag von Melanie Degel und Dr. Nona Bledow
Klimaschutz ist nötig, um die Grundlagen für die Freiheit zu erhalten.
Melanie Degel und Dr. Nona Bledow
Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung
Neben Freiheit gibt es allerdings ein zweites großes Schlagwort in Debatten um die Zulässigkeit von Klimaschutzmaßnahmen: Gerechtigkeit. Das zeigt sich beispielsweise schon im Titel der Stellungnahme des Ethikrates vom März dieses Jahres: „Klimagerechtigkeit“.
Einerseits bezieht sich Gerechtigkeit auf soziale Fragen und speziell darauf, wer die finanziellen Kosten trägt und ob ärmere Teile der Gesellschaft zu stark belastet werden. Es muss aber auch die Verflechtung von Freiheit und Gerechtigkeit mitgedacht werden. Freiheit und Gerechtigkeit hängen eng zusammen, auch im Kontext von Klimaschutzmaßnahmen.
Wer trägt heute die Lasten für die Freiheit von morgen?
Angenommen wir würden uns als Gesellschaft darin einig, wie viel Freiheit heute eingeschränkt werden darf, um die Freiheit morgen zu ermöglichen – dann bliebe die Frage, wer die Lasten oder die Freiheitseinschränkungen trägt. Hier sind Gerechtigkeitsfragen zentral: trägt nur ein Teil die Lasten, während alle von dem Erhalt zukünftiger Freiheit profitieren, haben wir ein Trittbrettfahrer-Problem.
Gerade im Bereich der Transformation der Energieversorgung wird dieser Zusammenhang deutlich. Eine schnelle Umstellung auf ein Energiesystem, das ohne klimaschädliche Emissionen bezahlbare Energie bereitstellen kann, ist zentral für den Klimaschutz. Erneuerbare Energien sind heute kostengünstig und nahezu emissionsfrei und deshalb unsere wichtigsten Zukunftsenergien. Weitere Lösungsansätze weisen in der Machbarkeit große Fragezeichen auf und können in der nötigen Schnelligkeit voraussichtlich nicht verlässlich umgesetzt werden – sie sind daher im Vergleich mit den Erneuerbaren eher Wunschenergien.
Jedoch bringen Erneuerbare Energien sowie der notwendige Netzausbau eine spezielle Art Lasten mit sich, weil sie große Flächen erfordern und sich auf Landschaft und Natur auswirken. Beim Ausbau der Windenergie spielen als ungerecht wahrgenommene Lastverteilungen eine Rolle, sowohl auf individueller Ebene als auch zwischen den Bundesländern. Die Menschen, die die Lasten des Windenergieausbaus tragen, leben vor allem in ländlichen Gebieten und profitieren häufig weder von Anlagen noch von deren Strom.
Das Ausbauziel des Bundes entspricht nicht dem Interesse der Länder, die auf lokaler Ebene mit den Auswirkungen des Ausbaus konfrontiert sind und deshalb versuchen, diese gering zu halten und sich eher auf die Ausbaubemühungen der anderen Bundesländer zu verlassen.
Gerechtigkeit braucht Raum für Kritik und Diskussion
In den letzten Jahren stockte der Ausbau erneuerbarer Energien auch wegen Widerständen und Kritik von Menschen vor Ort. Dabei wurde deutlich, wie wichtig es ist, Gerechtigkeit und Bedenken in der Bevölkerung ernstzunehmen. Partizipation, Öffentlichkeitsbeteiligung und finanzielle Teilhabe sollen Gerechtigkeit und Akzeptanz stärken. Einige Bundesländer haben Gesetze verabschiedet, die finanzielle Beteiligung ermöglichen. Auch auf Bundesebene können Betreiber von Wind- und Solarparks Gemeinden seit der EEG-Reform 2023 eine jährliche Zahlung von 0,2 Cent pro Kilowattstunde anbieten.
Die finanzielle Beteiligung ist vielen zwar wichtig, aber kein Allheilmittel für mehr Gerechtigkeit. Um die Ungleichverteilungen der Windanlagen zwischen Nord- und Süddeutschland zu verringern, adressierte die Bundesregierung ihre Verteilung im Windenergie-an-Land-Gesetzdirekt und verpflichtete alle Bundesländer zum gleichen Flächenanteil.
Als gerecht wahrgenommene Lösungen sind Basis einer gesellschaftlich getragenen Energietransformation. Bedenken aus der Bevölkerung sollten nachvollzogen werden, um Verfahren, Entscheidungsfindungen und Beteiligung für eine gerechtere Verteilung von Nutzen und Lasten hervorzubringen.
Es bleibt zu hoffen, dass dadurch die oft hitzigen Debatten über die Freiheit und deren Einschränkungen konstruktiver verlaufen. Wenn Maßnahmen gemeinsam entwickelt werden und als gerecht gelten, werden sie seltener als unzulässige Freiheitseinschränkung empfunden. Letztlich können nicht alle Konflikte aufgelöst werden, aber eine demokratische Gesellschaft sollte dennoch viele Möglichkeiten für Teilhabe und kontroverse Diskussion schaffen.

Melanie Degel
Melanie Degel ist Wirtschaftsingenieurin, sie leitet den Bereich Energie, Klima, Infrastrukturen am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Seit Jahren arbeitet sie mit Menschen aus der Praxis daran, die Energiewende voranzubringen. Sie motivieren die vielen oft überraschenden Lösungswege, die trotz der Konflikte gefunden werden.

Dr. Nona Bledow
Dr. Nona Bledow ist Wissenschaftlerin am Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung und vor allem im Bereich Energie, Klima, Infrastrukturen tätig. Zurzeit forscht sie für das Büro für Technikfolgenabschätzung am Deutschen Bundestag zu Fragen der Resilienz von soziotechnischen Infrastruktursystemen. Ihr akademischer Hintergrund umfasst Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und Philosophie.
Die hier veröffentlichten Inhalte und Meinungen der Autorinnen und Autoren entsprechen nicht notwendigerweise der Meinung des Wissenschaftsjahres 2024 – Freiheit.