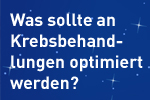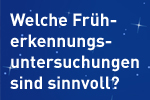Nicht schlicht Schicksal: Der Kampf gegen Krebs
Krebserkrankungen gehören zu den größten Herausforderungen, denen die Medizin gegenüber steht. Sie sind die zweithäufigste Todesursache in den Industrienationen. Weil Krebs (auch) eine Alterserkrankung ist, wird die Zahl der Patientinnen und Patienten im Zuge des demographischen Wandels zunehmen. Um den Krebs einzudämmen, kämpft die Forschung an vielen Fronten.
„Gegen Krebs kann man nichts machen“, das ist ein oft gebrauchter Satz. Richtig ist, dass die Krebsmedizin in den vergangenen zwanzig Jahren bei einigen Krebsformen enorme Fortschritte gemacht hat. Eine Leukämie bei Kindern ist heute kein Todesurteil mehr. Bei etwa acht von zehn Betroffenen kann die Krankheit geheilt werden. Bestimmte Blutkrebsformen im Erwachsenenalter sind durch die moderne Arzneimitteltherapie zu chronischen Erkrankungen geworden. Eine 50-jährige Frau, bei der Brustkrebs diagnostiziert wird, hat heute eine doppelt so hohe Überlebenschance wie ihre Mutter, wäre sie im gleichen Alter erkrankt.
Richtig ist aber auch, dass es andere Krebsformen gibt, bei denen sich längst nicht so viel verbessert hat. Vor allem Patientinnen und Patienten mit metastasierten Krebserkrankungen der soliden Organe haben nach wie vor eine schlechte Prognose. Auch Krebserkrankungen, die an chirurgisch schwer erreichbaren Stellen des Körpers liegen oder die spät erkannt werden, sind weiterhin ein Problem. Bösartige Tumore des Gehirns und der Krebs der Bauchspeicheldrüse gehören in diese Kategorien.
Die Krebsforschung der jüngsten Zeit hat das Verständnis der unterschiedlichen Krebsformen deutlich verbessert. Über die genetischen Veränderungen, die in ihrer Summe zu einer bösartigen Krebserkrankung führen, weiß man heute teilweise recht detailliert Bescheid. Das hat bei einigen Krebserkrankungen bereits Konsequenzen für die Therapie. Die Pathologie analysiert heute Krebsgewebe mit molekularbiologischen Methoden und kann aus den Ergebnissen Empfehlungen für jene Behandlungen ableiten, bei denen die Ansprechraten am größten sind.
Beim Brustkrebs beispielsweise suchen Pathologinnen und Pathologen nach Rezeptoren für bestimmte Hormone und Wachstumsfaktoren, weil das Aufschluss darüber gibt, ob Therapien sinnvoll sind, die diese Hormone und Wachstumsfaktoren gezielt blockieren. Insgesamt wird die Arzneimitteltherapie beim Krebs also immer stärker auf die individuelle Situation abgestimmt.
Parallel dazu werden auch die Krebschirurgie und die Bestrahlungstherapien immer präziser. Chirurginnen und Chirurgen wissen heute besser als früher, wie sie möglichst viel Tumorgewebe entfernen, ohne die Funktion des Organs zu sehr einzuschränken. Und in der Strahlentherapie werden die Bestrahlungen heute so geplant, dass das umgebende Gewebe möglichst geschont wird.
Ist eine bösartige Krebserkrankung erst einmal ausgebrochen, dann ist häufig eine aufwändige und teure Behandlung unter Einbeziehung unterschiedlicher medizinischer Fachdisziplinen erforderlich. Viel besser wäre es, wenn es gar nicht erst so weit kommt. Tatsächlich ist es möglich, Krebserkrankungen zumindest teilweise vorzubeugen. Fachleute schätzen, dass sich durch Prävention und gezielte Früherkennung jede zweite bis dritte Krebserkrankung vermeiden ließe. Eine wichtige Rolle spielt das Verhalten jedes Einzelnen. Der Verzicht auf Zigaretten verringert das Krebsrisiko deutlich, vor allem, aber nicht nur in der Lunge. Für mehrere Krebserkrankungen ist nachgewiesen, dass regelmäßige körperliche Bewegung einen gewissen Schutz bietet. Auch die Ernährung scheint an der Entstehung von Krebserkrankungen beteiligt zu sein.
„Eine Kernaufgabe in der Krebsforschung besteht darin, ständig die Ergebnisse der Grundlagenforschung auf neue Ansätze zur Prävention, Diagnostik und Behandlung von Krebserkrankungen hin zu überprüfen“, betont Professor Dr. Otmar D. Wiestler, Sprecher des Deutschen Konsortiums für Translationale Krebsforschung (DKTK) und Vorstandsvorsitzender des Deutschen Krebsforschungszentrums in Heidelberg. Das DKTK gehört zu den sechs von der Bundesregierung neu eingerichteten Deutschen Zentren der Gesundheitsforschung. An den acht Standorten des DKTK sind künftig mehr als 160 namhafte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihren Arbeitsgruppen diesem „translationalen“ Gedanken verpflichtet. Um ihn mit Leben zu erfüllen, wurden sieben Forschungsprogramme definiert, an denen sich immer mehrere Standorte beteiligen sollen. Im Einzelnen will man sich am DKTK um Signalwege in der Krebsentstehung, um die Molekulardiagnostik, um Krebsimmunologie und Immuntherapien bei Krebs, um Stammzellen, um Strahlentherapie und Bildgebung, um das Phänomen der Behandlungsresistenz und um Prävention und Früherkennung kümmern.