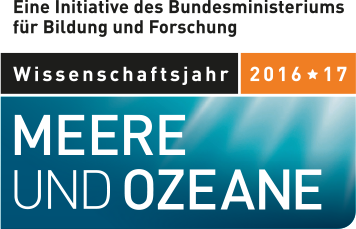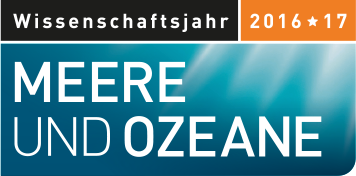Gefährdete Trinkwasserversorgung auf Borkum
Sie haben auf der Nordseeinsel Borkum die Veränderungen der Salz-Süßwassergrenze im Untergrund erforscht. Wann bedroht ungenießbares Salzwasser das lebenswichtige Trinkwasser? Das Team hat ein Messprinzip entwickelt, mit dem dieser Zeitpunkt rechtzeitig erkannt werden kann. Im nächsten Schritt geht es um die große Perspektive. Die Messungen sollen entlang der deutschen Küsten sowie auf weltweite Standorte ausgeweitet werden.

„Wir alle kennen die Bilder aus Bangladesch, wo durch den Anstieg des Meeresspiegels unterirdisch Salzwasser ins Land gedrückt wird. Die Problematik der veränderten Salz-Süßwassergrenze und damit versalzter Brunnen ist dort mancherorts heute schon akut", erklärt Helga Wiederhold vom LIAG. Darunter leiden sowohl die Trinkwasserversorgung als auch die Landwirtschaft. Wird zu viel trinkbares Grundwasser verbraucht, dann drängt von der Meerseite Salzwasser in den Untergrund und vermischt sich mit dem Süßwasser. Verhindern lässt sich dieses Problem weltweit nur durch kluge Bewirtschaftung der Wasserreserven und vorausschauendes Planen.
Auch an den norddeutschen Küsten seien Veränderungen der Salz-Süßwassergrenze zu erwarten, so Wiederhold. Wenn auch weniger drastisch. Auf Borkum wurden seit 2009 kontinuierlich geoelektrische Messungen durchgeführt. Die Qualität und Ausdehnung der Süßwasserlinse im Untergrund Borkums wird permanent beobachtet, um Grenzverschiebungen zwischen Trinkwasser und Salzwasser rechtzeitig zu erkennen und nachhaltig mit dem Grundwasser zu wirtschaften. Süßwasserlinse nennen Expertinnen und Experten den Wasservorrat, der küstennahe Orte mit Grundwasser versorgt. Borkum verfügt über eine Linse mit 60 Meter Durchmesser.
Unter internationaler Beteiligung wurde am LIAG jetzt das TOPSOIL-Projekt aufgelegt. Dieses Projekt erforscht die Anpassungsfähigkeit der Nordseeregion an den Klimawandel. Die auf Borkum gesammelten Erkenntnisse sind jedoch nicht nur auf die Nordseeregion übertragbar. Das Messverfahren soll auch international eingesetzt werden. „Im dem vom Bund finanzierten Forschungsprojekt go-CAM haben wir die Chance, diese Technologie jetzt auch in die Welt zu tragen und Strategien für nachhaltige Wasserversorgung im Nordosten Brasiliens, an der Südküste der Türkei und am Ostkap in Südafrika zu entwickeln", erläutert Wiederhold die weiteren Perspektiven. „Es bleibt spannend und es ist ein gutes Gefühl, so ein kleines bisschen zu den nachhaltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nationen beizutragen."
16.11.2017

in Kooperation mit dem