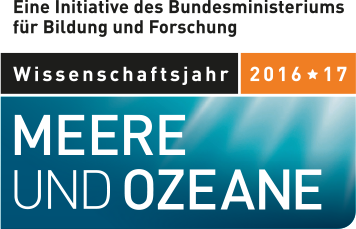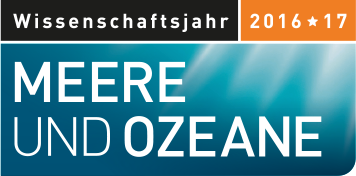Sturmfluten und Monsterwellen im Labor
Ein Warngeräusch ertönt, Lampen leuchten auf, die Wellenmaschine läuft langsam an. Innerhalb von zwei Minuten werden die Wellen immer größer. Am hinteren Ende des Kanals schlagen die Wellen an der sogenannten Böschung auf. Mit einer Gesamtleistung von 900 Kilowatt kann die Wellenmaschine des GWK sogar die Stärke von Tsunamis simulieren. Strömungen, Strudel, Wellen – im Meer wirken unvorstellbar starke Kräfte. Bis jetzt sind sie aber für den Menschen nicht nutzbar. Das FZK gehört zu den führenden Forschungseinrichtungen, die Energiegewinnung durch Wellenenergie testen. Auch die Wirkung der Wellen auf Strände und Dünen sowie auf Küstenschutzwerke wird hier untersucht.

Mit etwa 300 Metern Länge, fünf Metern Breite, sieben Metern Tiefe und Wellenhöhen bis zu über drei Metern zählt der GWK zu den größten Versuchseinrichtungen seiner Art weltweit. Um aber die Herausforderungen zu simulieren, vor denen die Industrie beim Bau von Windenergieanlagen auf hoher See, aber auch bei Wellen- oder Tideströmungskraftwerken steht, bedarf es eines Ausbaus. Mit dem erweiterten ‚Großen Wellenkanal’ entsteht erstmals in Deutschland ein Versuchsstand für eine vollumfängliche Belastung maritimer Bauwerke. In Zukunft werden die Forscherinnen und Forscher untersuchen können, welchen Kräften Offshore-Windenergieanlagen sowohl durch Seegang als auch durch Strömung ausgesetzt sind. Weltweit existieren nur vier weitere vergleichbare Anlagen.
Der Ausbau findet im Rahmen des Forschungsprojektes „marTech – Erprobung und Entwicklung maritimer Technologien zur zuverlässigen Energieversorgung“ statt. Rund 35 Millionen Euro stellt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) für die Erweiterung des Wellenkanals zur Verfügung. Weitere 1,4 Millionen Euro hat das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur (MWK) für die Planungsphase beigesteuert. „Mit dem Projekt „marTech“ soll auch ein wesentlicher Beitrag zur Erprobung und Entwicklung von Technologien der erneuerbaren Energien auf und aus dem Meer geleistet werden. Dies stützt auch unmittelbar den Forschungsschwerpunkt Energie, den die Leibniz Universität auf vielen Gebieten interdisziplinär verankert hat“, beschreibt Professor Volker Epping, Präsident der Leibniz Universität Hannover, die Zielsetzung.
19.10.2017

in Kooperation mit dem